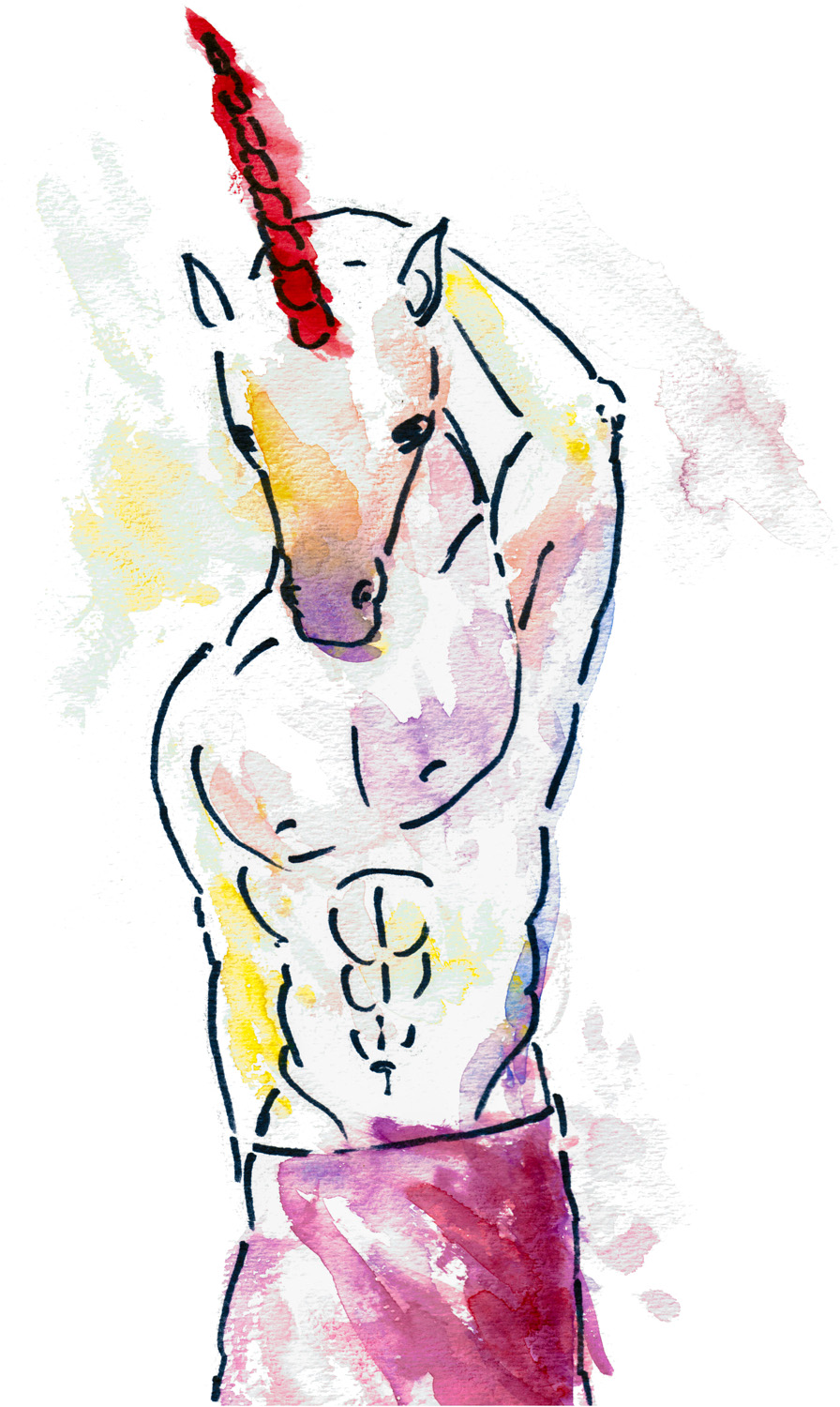Egal ob schwul, hetero, bi, lesbisch oder transgender: Wir sind alle auf dem richtigen Weg. LGBTs sind ziemlich gut akzeptiert, dennoch gibt es die einen oder anderen Probleme.
Schwule sind sensibel und tuntig. Lesben haben kurze Haare und spielen Fussball. In der Homobeziehung gibt es immer eine Männer- und eine Frauenrolle. Sie geben viel für ihr Äusseres, sind schrill. Hauptsache Glitzer! Schwulsein ist noch immer mit Klischees behaftet, obwohl vermutlich viele Leute auch Homosexuelle zu ihrem Freundeskreis zählen. Zum Besseren wendet sich mit Diskriminierungsschutz und Partnerschaftsgesetz zwar je länger je mehr die Rechtslage für die LGBT-Gemeinde. Im Alltag viel bedeutender ist aber für viele Homosexuelle nicht die Rechtslage, sondern die gesellschaftliche Ausnahmestellung, die sie noch immer einnehmen. Öffentliches Händchenhalten oder sich im Trischli auf der Tanzfläche abzuknutschen, bedeutet häufig, verdutzte Blicke zu ernten. Ein homophober Spruch lässt dann auch oft nicht lange auf sich warten.
Bin ich schwul?
Eigentlich ist Homophobie aber längst nicht mehr gesellschaftsfähig, denn wer gegen jemandes freie Wahl, sich in das selbe Geschlecht zu verlieben, Hass schürt, darin eine Anomalität sieht, hat schlicht eine irrationale und sachlich durch nichts zu begründende Angst vor homosexuellen Menschen und ihrer Lebensweise. Trotzdem trifft ein Betroffener noch heute auf Einschränkungen und böse Worte.
Vielleicht noch in der Sekundarschule, wo ich selber nicht ganz einig war, ob ich es nun bin oder nicht, da war es mir noch fremd zu sagen, ich stehe (auch?) auf Männer. In der Berufsschule hatte ich dann nach der zweiten Freundin endlich einen Freund und noch etwas später war ich stolz, zu meiner Sexualität zu stehen.Probleme hatte ich nie, wurde nie angepöbelt und verlor keine Freunde durch mein Outing. Lange Zeit bin ich davon ausgegangen, dass es der Mehrheit der Homos so geht.
Karma Wellauer, Präsident von Unigay, weiss aber, dass es nicht jedem leicht gemacht wird. «Wir haben sogar Mitglieder, die ungeoutet sind», bestätigt er. Von der eigenen Familie nicht akzeptiert, von Freunden verlassen zu werden oder die Angst, einen Job aufgrund von Diskriminierung nicht zu bekommen, seien durchaus ernst zu nehmende Sorgen. Als junger Student weg von zu Hause zu gehen und an die Uni zu kommen, sieht Karma als die Gelegenheit, seine Sexualität das erste Mal offen zu leben. In einem neuen Setting mit neuen Freunden die Homosexualität nicht zu verleugnen, das tut gut. «So war es auf jeden Fall bei mir», fügt er an.
Sittliches Empfinden
Schwierigkeiten standen auch die Gründer der Homosexuellen Arbeitsgruppe St. Gallen (HASG) 1973 gegenüber. Nach dem Gründungsaufruf zur neuen Studentenvereinigung in der Februarausgabe von prisma von damals ermahnte sie der Rektor daraufhin prompt, den Namen aufgrund starker Ähnlichkeit zur HSG zu ändern. Bei der Eröffnung des Postfaches musste zunächst das «sittliche Empfinden» der Post St. Gallen überwunden werden und benötigte eine Genehmigung der Kreispostdirektion. Auch die Stadtpolizei war skeptisch und liess sich vom Wirt des Restaurants, in dem die HASG ihre Treffen abhielt, Auskünfte über die Gruppe geben. Sie begründete das in einem Schreiben damit, dass es unter anderem Aufgabe der Polizei sei, «sich im Zusammenhang mit der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung über kriminalsoziologisch bedeutsame Gruppen zu informieren». Zu diesen Gruppen gehörten an sich auch solche, deren Ursprung Perversionen seien. Weiter hielt sie fest, dass «geschlechtliche Verirrungen (im Sinne von Abweichungen von einer biologischen Norm)» tatsächlich kriminogene Faktoren seien.
Abo gekündigt
Nach diesem prisma im Februar 1973, welches übrigens auf 10 von 62 Seiten das Thema Homosexualität behandelte, bestellte ein Honorarprofessor unserer Uni (Name unbekannt) postwendend das prisma-Abo mit der Begründung ab, dass er an einem Mitteilungsblatt für Homosexuelle nicht interessiert sei. Ob sich das nach dieser aktuellen Nummer von prisma wiederholt, möchten wir an dieser Stelle bezweifeln. Wie sieht es denn nun über vierzig Jahre später mit der Akzeptanz aus, fragen wir Karin Hostettler, Genderforscherin an der School of Humanities and Social Sciences (SHSS). «Nach wie vor geht die Gesellschaft davon aus, dass Heterosexualität das Normale ist.» Somit seien alle anderen sexuellen Orientierungen erklärungsbedürftig und der Schwule oder die Lesbe müsse sich immer wieder outen. Das Gleiche gilt am Arbeitsplatz, wenn über das Wochenende berichtet, von den Kindern gesprochen wird oder ich gefragt werde, ob ich auch meine Frau an das Weihnachtsessen mitnehme. Sollte nicht korrekterweise nach dem Partner gefragt werden?
Viele Unternehmen haben heutzutage Diversity-Programme, die Verschiedenartigkeiten aller Arten fördern. Frauen, Familienväter, Behinderte, Junge, Ü50 und eben auch LGBTs. Hilft das homosexuellen Uniabsolventen, die Angst zu nehmen, im neuen Arbeitsumfeld nicht akzeptiert zu werden?
«Diversityprogramme helfen sicher, dass auch über Homosexuelle am Arbeitsplatz geredet wird. Die Visibility ist der erste Schritt zur Akzeptanz», sagt Karma. Genau, denn Schwulsein haftet das Klischee einer tanzenden schrillen Meute am Christopher Street Day oder dem Pride Festival an. Aber Schwule können auch ganz normale Menschen wie du und ich sein. Schwul sind auch Schauspieler, Politiker, Professoren der HSG und Fussballer (Thomas Hitzlsperger war 2014 der erste deutsche Profi, der sich outete). Und Homosexualität geht auch im Kontext der Arbeit. So empfindet auch Hostettler, dass der Fokus weggehe von der Frage nach Diskriminierung hin zu einem Verständnis von Diversity als Ressource für das Unternehmen. Ob türkisch, klein, pummelig, jüdisch, mit Brille oder schwul. Der Mensch ist halt eben so, wie er geboren ist. Wäre auch schrecklich langweilig, wären wir alle gleich.
Illustration Nadia Kuzniar, Samuel Holenstein hat zu diesem Artikel beigetragen