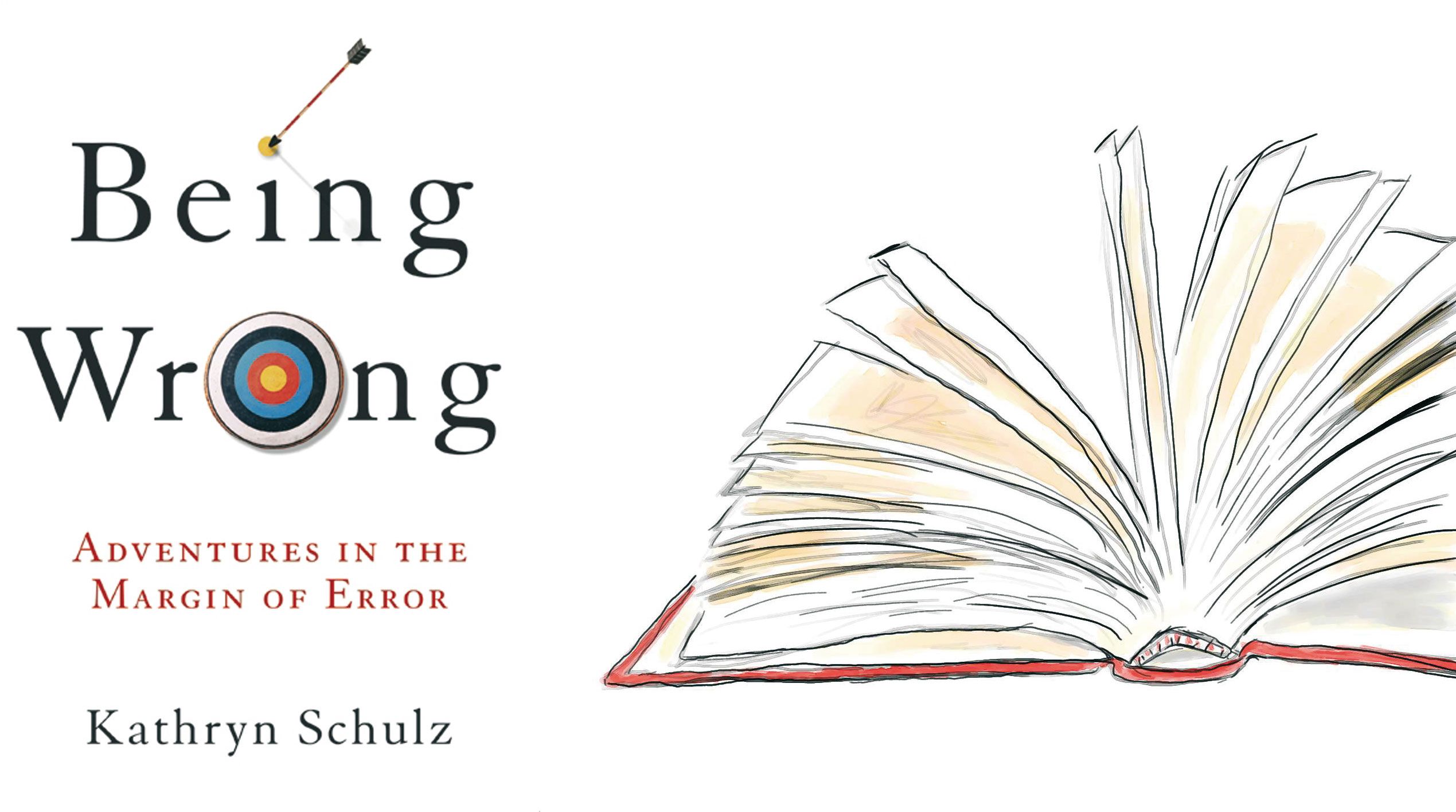Irren ist menschlich. Warum können wir unsere Fehler dennoch nur schwer akzeptieren? Der Frage geht die amerikanische Journalistin Kathryn Schulz in ihrem jüngst in den USA erschienenen Buch nach.
Was «Being Wrong» amüsant macht, ist das Sammelsurium an Pleiten, Pech und Pannen. Schulz berichtet beispielsweise von einem Kollegen, der in seinem Leitartikel einer einflussreichen Dame eine Schwangerschaft angedichtet hat, wo sich lediglich reger Appetit verbarg. Jahre später, die Dame war bereits beerdigt, ist der Journalist noch immer genauso ungehalten über seinen Fauxpas wie am ersten Tag.
So weit ist das Schulz‘sche Buch locker-leichte Lektüre. Dann jedoch kommen ernstere Irrtümer zur Diskussion, wie die Geschichte von Hannah. Die Österreicherin erlitt vor einigen Jahren einen Schlaganfall und wurde zur Behandlung an einen Neurologen verwiesen. «Beschreiben Sie mich», forderte der Mediziner sie auf. Hannah tat es, Detail für Detail. Nicht einmal die leichte Sommerbräune des Arztes liess sie aus. Das Problem nur – Hannah war blind. Sie litt unter dem so genannten Anton-Syndrom: Die Patientin leugnete ihre Blindheit nicht nur vehement, sondern glaubte tatsächlich, problemlos sehen zu können.
«Auch wir sind an dem einen oder anderen Punkt in unserem Leben wie Hannah: Wir haben keine Ahnung, dass wir mit unseren Einschätzungen völlig danebenliegen», schreibt Schulz. Laut der Autorin fabulieren wir vor uns hin, erfinden und erdichten Details, die unsere brüchige Richtigkeit aufrechterhalten sollen – weil wir sie brauchen. Richtig zu liegen bezüglich unwichtiger wie wichtiger Dinge, bietet Stabilität und Halt, im weiteren Sinne auch die Kontrolle einer generell chaotischen Welt. Fehler sind daher emotional so aufreibend, weil sie unser Welt- und sogar Selbstbild auf den Kopf stellen können, so die Autorin.
Schulz führt dem Leser anschliessend die kognitiven Mechanismen vor Augen, aufgrund welcher der Mensch erstaunliche Leistungen im Alltag vollbringen kann, gleichzeitig aber zu einem fehlbaren Wesen wird. Zu diesen Mechanismen gehört das induktive Denken: Induktion bietet eine Strategie für den Umgang mit der Informationsflut, welcher der Mensch mit seinen Sinnen ausgeliefert ist. Das induktive Denken ermöglicht Vereinfachungen und Projektionen. Wenn es beispielsweise heisst: Vervollständige den Satz «Die Giraffe hat einen langen ____», denken wir fast sofort an «Hals». Verglichen mit uns kann ein Computer diesen Satz nicht problemlos lösen, denn es gibt einige passende Wörter: Nacken, Wirbelsäuleknochen, Käfig, Weg aus Kenia etc. Aber unsere vereinfachende Denkweise geht nicht alle Möglichkeiten durch, sonst sässen wir tagelang an der Aufgabe. Stattdessen selektieren wir rasch, unter anderem nach dem Prinzip der Wahrscheinlichkeit. Deshalb ist es nicht überraschend, dass induktives Denken stark fehleranfällig ist.
Kein Grund zum Verzagen, besänftigt Autorin Schulz, denn die menschliche Fehlbarkeit liefert den Stoff für Kulturwerke von Shakespeare bis Hollywood. Wie sehr irrt doch Romeo bezüglich Julias vermeintlichem Tod. Nicht minder täuscht sich Dom Cobb in «Inception», der ähnlich wie Patientin Hannah Dinge sieht, die nicht existieren. «Irrtümer sind Bestandteil der Kultur, als solche geniessen wir sie», betont Schulz. Ihr Buch ist weder Ratgeber noch seichte Pop-Science, sondern konfrontiert auf spannende Weise mit einem oft beiseitegelassenen Thema.